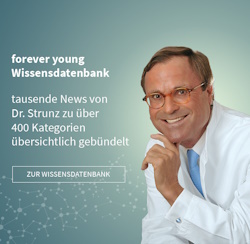Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Kupfer – ein oft vergessenes Spurenelement
Noch vor wenigen Generationen war es selbstverständlich, dass Leber, Niere oder Herz ihren Platz in der heimischen Küche hatten. Sie galten als kräftigend, nahrhaft und lieferten wertvolle Spurenelemente, ganz natürlich und ohne Zusatzstoffe. Heute jedoch haben viele Menschen den Geschmack daran verloren – oder schlicht vergessen, wie vielseitig diese Zutaten sind. Innereien gelten als „aus der Mode gekommen“, wurden von modernen Ernährungsgewohnheiten verdrängt.<7p>
Doch mit dieser Entwicklung ging uns mehr verloren als nur ein kulinarisches Erbe: Auch eine der wichtigsten natürlichen Quellen für das Spurenelement Kupfer verschwand aus unserem Alltag. Dabei spielt Kupfer eine zentrale Rolle für unseren Stoffwechsel, das Immunsystem und die Energieproduktion – und ist gerade in Zeiten einseitiger Ernährung wichtiger denn je.
Kupfer wirkt im Körper nicht isoliert, sondern überwiegend als zentraler Aktivator vieler Enzyme, wie z. B. die Superoxiddismutase (SOD) oder das Leberentgiftungsenzym CYP450. Diese steuern lebenswichtige Prozesse – von der Energieproduktion über die Blutbildung, das Nervensystem und die Entgiftung.
Auch für gesunde Haut, Knochen und Nerven spielt Kupfer eine Rolle: Es fördert die Bildung von Bindegewebe, Pigmenten und schützt die Nervenfasern durch den Aufbau der Myelinschicht.
Besonders spannend ist seine Verbindung zur Diaminoxidase (DAO) – einem wichtigen Enzym, das Histamin abbaut. Ohne Kupfer läuft bei der Diaminoxidase nichts: Das Spurenelement ist das Zentralatom des Enzyms und damit entscheidend für seine Aktivität. Eine gute Kupferversorgung kann daher die DAO-Funktion unterstützen und Beschwerden bei Histaminintoleranz verringern.
Da der Körper Kupfer nicht selbst bilden kann, muss es über die Nahrung aufgenommen werden. Gute Quellen sind:
- Innereien (primär Leber)
- Schalentiere (z. B. Austern, Krabben)
- Nüsse und Samen (Cashews, Sonnenblumenkerne)
- Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte
- Kakao und dunkle Schokolade
Unsere Vorfahren deckten ihren Bedarf meist mühelos. Heutzutage ist Kupfer oft im Mangel.
Kupfer kann im Serum oder Vollblut gemessen werden. Doch das allein reicht nicht, um den tatsächlichen Kupferstatus zuverlässig zu beurteilen.
Etwa 90 % des Kupfers im Blut sind an ein Transportprotein namens Coeruloplasmin gebunden. Deshalb sollte bei jeder Untersuchung immer auch Coeruloplasmin mitbestimmt werden.
Nur die Kombination aus Kupfer- und Coeruloplasminwert ermöglicht eine korrekte Einschätzung:
- Ist Coeruloplasmin zu niedrig, kann trotz normalem Gesamtkupfer ein funktioneller Kupfermangel vorliegen.
- Ist Coeruloplasmin erhöht – etwa bei Entzündungen –, kann der Kupferwert fälschlich zu hoch erscheinen.
Nur wenn beide Werte gemeinsam betrachtet werden, lässt sich erkennen, ob tatsächlich ein Mangel besteht oder ob das Kupfer im Körper richtig gebunden und verfügbar ist.
Ein Mangel entwickelt sich langsam und kann viele Organsysteme betreffen.
Typische Anzeichen sind:
- Müdigkeit und Blässe durch Blutarmut
- Schwächung des Immunsystems und erhöhte Infektanfälligkeit
- Neurologische Symptome wie Kribbeln, Muskelschwäche oder Konzentrationsstörungen
- Haut- und Haarveränderungen, etwa brüchiges oder ergrautes Haar
- Verstärkte Histaminreaktionen durch eine verminderte DAO-Aktivität
So wichtig Kupfer auch ist – eine unüberlegte Einnahme kann mehr schaden als nützen. Eine Substitution sollte immer auf Laborwerten beruhen und nicht „auf Verdacht“ erfolgen. Bei einem Mangel hat sich die Gabe von 1- 2 mg Kupferbisglycinat als hilfreich erwiesen, am besten nach einer Mahlzeit.
Kein Kupfer sollte ergänzt werden, wenn:
- Der Kupferwert normal oder erhöht ist.
Ein Überschuss kann oxidativen Stress fördern und andere Spurenelemente, vor allem Zink, aus dem Gleichgewicht bringen. - Eine Störung des Kupferstoffwechsels vorliegt, z. B. Morbus Wilson.
In solchen (sehr seltenen) Fällen kann sich Kupfer im Gewebe anreichern und Organschäden verursachen.
Zink und Kupfer beeinflussen sich gegenseitig. Wird zu viel Kupfer eingenommen, kann ein Zinkmangel entstehen – und umgekehrt. Es macht daher Sinn, Kupfer und Zink gemeinsam einzunehmen, z. B. in der Kombination von 20 mg Zink und 1 mg.
Quellen:
Chen J, Jiang Y, Shi H, Peng Y, Fan X, Li C. The molecular mechanisms of copper metabolism and its roles in human diseases. Pflugers Arch. 2020 Oct;472(10):1415-1429. doi: 10.1007/s00424-020-02412-2. Epub 2020 Jun 7. PMID: 32506322.
Xue Q, Kang R, Klionsky DJ, Tang D, Liu J, Chen X. Copper metabolism in cell death and autophagy. Autophagy. 2023 Aug;19(8):2175-2195. doi: 10.1080/15548627.2023.2200554. Epub 2023 Apr 16. PMID: 37055935; PMCID: PMC10351475.
Über die Autorin:
"Kyra Kauffmann, Jahrgang 1971, Mutter zweier kleiner Söhne, Volkswirtin, seit 20 Jahren niedergelassene Heilpraktikerin, Buchautorin, Dozentin, Journalistin und seit 3 Jahren begeisterte Medizinstudentin.
Zur Medizin kam ich durch meine eigene schwere Erkrankung mit Anfang 30, bei der mir seinerzeit kein Arzt wirklich helfen konnte. („Ihre Werte sind alle super – es ist alles rein psychisch!“). Hilfe bekam ich von Heilpraktikern, die zunächst einmal eine wirklich gründliche Labordiagnostik durchgeführt haben, ganz nach dem Vorbild von Dr. Ulrich Strunz. Es war eine neue Welt, die sich mir eröffnete und die Erkenntnisse, haben mich sofort fasziniert (ohnehin bin ich ein Zahlen-Daten-Fakten-Fan und habe nicht umsonst das Studium der VWL gewählt). Die Begeisterung war so groß, dass ich meinen alten Beruf an den Nagel hängte und Heilpraktikerin wurde. Meine Praxis führe ich seit 20 Jahren mit großer Begeisterung und bin – natürlich - auf Labordiagnostik spezialisiert und kann so oft vielen Symptomen auf den Grund gehen. In 2 Jahren hoffentlich dann auch als Ärztin.