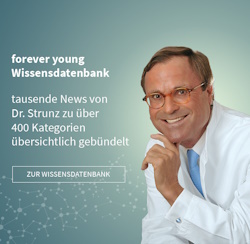Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Der Wolff-Chaikoff-Effekt – Wenn die Schilddrüse auf die Bremse tritt
In letzter Zeit bekomme ich vermehrt Leser-Anfragen rund um die Jod-Therapie, besonders zum sogenannten Wolff-Chaikoff-Effekt. Deshalb möchte ich heute genauer darauf eingehen.
Bekanntermaßen produziert die Schilddrüse die Hormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3). Diese steuern unseren Stoffwechsel, unsere Energie und auch das Herz-Kreislauf-System. Damit die Schilddrüse ihre Arbeit tun kann, braucht sie ausreichende Mengen an Jod.
Normalerweise nimmt sie Jod in kleinen Mengen über die Nahrung auf – etwa über Algen, Meeresfrüchte, jodiertes Speisesalz oder Fisch. Die durchschnittliche Jodzufuhr hierzulande beträgt allerdings nur etwa 75 mcg/Tag, obwohl der Bedarf der Schilddrüse allein mindestens 200 mcg/Tag beträgt. Schätzungsweise weitere 200 mcg pro Tag benötigen die anderen jodverbrauchenden Organe des Körpers. Doch was passiert, wenn plötzlich sehr viel Jod, z. B. statt der durchschnittlichen Gabe von 75 mcg pro Tag auf einmal 5 mg oder mehr pro Tag, in den Körper gelangt? Dann kommt es häufig zu einer kurzfristigen Produktionsunterbrechung der Schilddrüse. Dies wurde bereits im Jahre 1948 von zwei Forschern beschrieben: Jan Wolff und Israel Lyon Chaikoff. Sie entdeckten, dass die Schilddrüse bei einer plötzlichen Jodüberflutung die Notbremse zieht. Sie blockiert für kurze Zeit ihre eigene Hormonproduktion, um sich vor einer Überlastung zu schützen.
Das heißt: Für einige Tage werden weniger Hormone freigesetzt, und die Stoffwechsellage verschiebt sich Richtung Unterfunktion (Hypothyreose). Nach einigen Tagen „gewöhnt“ sich die Schilddrüse meist an die Situation und nimmt die Arbeit wieder auf – man spricht vom Escape-Phänomen. Bleibt dieser Mechanismus aus, kann eine dauerhafte Unterfunktion entstehen. Dies habe ich leider mehrmals in der Praxis erlebt, mit plötzlichem TSH-Anstieg auf über 100 mIU/l (Normwerte: 0,4 – 4,0 mIU/l). TSH ist das Hormon, das die Hypophyse ausschüttet, um die Schilddrüse zur Arbeit anzufeuern. TSH wird auch oft fälschlicherweise als „Schilddrüsenwert“ bezeichnet. Ein so hoher TSH-Wert zeigt die Not der Hypophyse. Sie gibt alles, damit die Schilddrüse wieder arbeitet, das tut sie aber (oft nur vorübergehend) nicht.
Wann tritt dieser Wolff-Chaikoff-Effekt in der Praxis auf? Immer dann, wenn plötzlich sehr viel Jod verabreicht wird, z. B.:
- Röntgenuntersuchungen mit jodhaltigen Kontrastmitteln
- Amiodaron, ein Medikament gegen Herzrhythmusstörungen, ist stark jodhaltig.
- Braunalgenpräparate oder Jodtinkturen, wie die Lugol‘sche Lösung, die ohne längeres Einschleichen eingenommen werden, können bei übermäßigem Gebrauch denselben Effekt auslösen.
- Bei Nuklearunfällen wird Kaliumjodid in hohen Mengen (z. B. 30 mg pro Tag) verabreicht. Damit wird die Schilddrüse mit stabilem Jod „gesättigt“ und nimmt kein radioaktives Jod (Iod-131) mehr auf.
Es gibt auch das Gegenteil: den Jod-Basedow-Effekt. Bei Menschen mit Schilddrüsenknoten oder einer Neigung zu Morbus Basedow oder auch bei Hashimoto Thyreoiditis kann eine hohe Menge an Jod eine Überfunktion auslösen. Während also der Wolff-Chaikoff-Effekt eine Bremse ist, wirkt der Jod-Basedow-Effekt wie Gas.
Nach mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Schilddrüsentherapie habe ich gelernt: Die Schilddrüse ist sehr empfindlich. Besonders wenn sie lange Zeit im Jodmangel war, reagiert sie bei jeder Person unterschiedlich auf Jod. Deshalb ist eine enge Kontrolle der Schilddrüsenwerte (TSH, fT3, fT4, reverse T3) unverzichtbar.
Gerade bei einer Jod-Hochdosistherapie mit Lugolscher Lösung sollte vor Beginn und auch während der Behandlung immer eine gründliche Überwachung stattfinden – inklusive Ultraschall.
Der Wolff-Chaikoff-Effekt zeigt deutlich, wie klug unser Körper funktioniert. Die Schilddrüse hat eine eingebaute Bremse, die sie vor einer Jodüberladung schützt. Für die meisten Menschen ist das ein vorübergehender, unproblematischer Vorgang. In besonderen Situationen – etwa bei bestehenden Schilddrüsenerkrankungen (Hashimoto Thyreoiditis) bei spezieller Medikation – lohnt sich jedoch ein genauer labordiagnostischer Blick.
Quellen:
WOLFF J, CHAIKOFF IL. The inhibitory action of iodide upon organic binding of iodine by the normal thyroid gland. J Biol Chem. 1948 Feb;172(2):855. PMID: 18901214.
Saller B, Fink H, Mann K. Kinetics of acute and chronic iodine excess. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1998;106 Suppl 3:S34-8. doi: 10.1055/s-0029-1212044. PMID: 9865552.
Über die Autorin:
"Kyra Kauffmann, Jahrgang 1971, Mutter zweier kleiner Söhne, Volkswirtin, seit 20 Jahren niedergelassene Heilpraktikerin, Buchautorin, Dozentin, Journalistin und seit 3 Jahren begeisterte Medizinstudentin.
Zur Medizin kam ich durch meine eigene schwere Erkrankung mit Anfang 30, bei der mir seinerzeit kein Arzt wirklich helfen konnte. („Ihre Werte sind alle super – es ist alles rein psychisch!“). Hilfe bekam ich von Heilpraktikern, die zunächst einmal eine wirklich gründliche Labordiagnostik durchgeführt haben, ganz nach dem Vorbild von Dr. Ulrich Strunz. Es war eine neue Welt, die sich mir eröffnete und die Erkenntnisse, haben mich sofort fasziniert (ohnehin bin ich ein Zahlen-Daten-Fakten-Fan und habe nicht umsonst das Studium der VWL gewählt). Die Begeisterung war so groß, dass ich meinen alten Beruf an den Nagel hängte und Heilpraktikerin wurde. Meine Praxis führe ich seit 20 Jahren mit großer Begeisterung und bin – natürlich - auf Labordiagnostik spezialisiert und kann so oft vielen Symptomen auf den Grund gehen. In 2 Jahren hoffentlich dann auch als Ärztin.