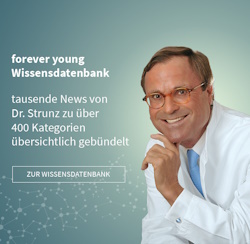Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Der Nobelpreis für Medizin 2025: Ein Durchbruch in der Immunologie
Autoimmunerkrankungen und ihre Entstehung gehören bis heute zu den großen Rätseln der Medizin. Ich denke dabei nicht nur an die Hashimoto-Thyreoiditis, Diabetes mellitus Typ 1 oder Rheuma, sondern auch an die komplexen Erkrankungen wie den systemischen Lupus erythematodes oder die granulomatöse Vaskulitis mit Polyangiitis. Es sind schwere, seltene Krankheitsbilder, die ich im Rahmen meiner klinischen Ausbildung kennengelernt habe. Es sind Erkrankungen, die massiv in das Leben der Betroffenen eingreifen und großes Leid und bis hin zum Tod verursachen. Und die Medizin ist hier oftmals machtlos.
Warum beginnt ein Immunsystem, das eigentlich zum Schutz des Körpers da ist, plötzlich, körpereigene Zellen anzugreifen?
Ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis liegt in der Regulation unseres Immunsystems. Es muss einerseits stark genug sein, um Krankheitserreger abzuwehren – und zugleich präzise genug, um das eigene Gewebe zu verschonen. Bis vor wenigen Jahrzehnten war nur bekannt, dass ein Mechanismus namens „zentrale Toleranz“ im Thymus über die Eliminierung fehlerhafter T-Zellen unser Selbst schützt. Bei diesem Prozess werden während der T-Zell-Reifung im Thymus autoreaktive T-Zellen eliminiert, um Selbsttoleranz zu gewährleisten und Autoimmunität zu verhindern.
Doch das allein erklärte nicht die Vielzahl von Autoimmunreaktionen im Körper. Es musste noch einen weiteren Prozess außerhalb des Thymus geben.
Am 6. Oktober 2025 wurde der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin an drei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin vergeben, die das Verständnis von Autoimmunerkrankungen maßgeblich erweitert haben: Mary E. Brunkow (USA), Fred Ramsdell (USA) und Shimon Sakaguchi (Japan). Sie wurden gemeinsam ausgezeichnet „für ihre Entdeckungen bezüglich der peripheren Immun¬toleranz“.
Bereits im Jahr 1995 machte der japanische Immunologe Shimon Sakaguchi eine bahnbrechende Entdeckung: Er identifizierte eine besondere Untergruppe von T-Zellen – die regulatorischen T-Zellen (Tregs). Diese Zellen entstehen im Thymus, während der Reifung der T-Zellen erkennen einige CD4⁺-T-Zellen körpereigene Antigene mit mittlerer Affinität – also weder zu schwach noch zu stark.
Nach ihrer „Ausbildung“ verlassen die Tregs den Thymus und zirkulieren im peripheren Immunsystem – also in Blut, Lymphknoten und Geweben. Dort übernehmen sie ihre zentrale Aufgabe: Sie sorgen für Selbsttoleranz und verhindern, dass das Immunsystem körpereigene Strukturen angreift. Mit anderen Worten: Sie entstehen im Thymus, aber wirken in der Peripherie – als Hüter des immunologischen Gleichgewichts.
Ein entscheidender Schritt für die Entwicklung von Tregs ist dabei ist die Aktivierung des Transkriptionsfaktors FOXP3. Im Jahr 2001 entdeckten Mary Brunkow und Fred Ramsdell das Gen FOXP3, das die Bildung dieses entscheidenden Transkriptionsfaktors steuert. Mutationen in diesem Gen führen zu schweren Autoimmunerkrankungen.
Zusammen lieferten sie das vollständige Bild: Tregs und FOXP3 sind der essenzielle Mechanismus der so genannten peripheren Immuntoleranz, also jener Kontrolle von Immunreaktionen außerhalb der Thymus-Eliminierung.
Wenn man nun versteht, wie das Immunsystem nicht den eigenen Körper angreift, eröffnet sich ein neues Feld für Therapien – z. B. bei Autoimmunerkrankungen oder auch nach Organtransplantationen.
Der Nobelpreis 2025 für Medizin würdigt damit eine fundamentale Entdeckung: Wie unser Immunsystem lernt, zwischen Fremd und Eigen zu unterscheiden – und wie es sich selbst reguliert.
Die Forschungen von Brunkow, Ramsdell und Sakaguchi legen hoffentlich den Grundstein für zukünftige Therapien, die über die bloße Symptombehandlung hinausgehen und darauf abzielen, das Immunsystem selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Quellen:
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2025/popular-information/?utm_source=chatgpt.com
Sakaguchi S, Sakaguchi N, Asano M, Itoh M, Toda M. Pillars article: immunologic self-tolerance maintained by activated T cells expressing IL-2 receptor α-chains (CD25). Breakdown of a single mechanism of self-tolerance causes various autoimmune diseases. J. Immunol. 1995. J Immunol. 2011 Apr 1;186(7):3808-21. PMID: 21422251.
Über die Autorin:
"Kyra Kauffmann, Jahrgang 1971, Mutter zweier kleiner Söhne, Volkswirtin, seit 20 Jahren niedergelassene Heilpraktikerin, Buchautorin, Dozentin, Journalistin und seit 3 Jahren begeisterte Medizinstudentin.
Zur Medizin kam ich durch meine eigene schwere Erkrankung mit Anfang 30, bei der mir seinerzeit kein Arzt wirklich helfen konnte. („Ihre Werte sind alle super – es ist alles rein psychisch!“). Hilfe bekam ich von Heilpraktikern, die zunächst einmal eine wirklich gründliche Labordiagnostik durchgeführt haben, ganz nach dem Vorbild von Dr. Ulrich Strunz. Es war eine neue Welt, die sich mir eröffnete und die Erkenntnisse, haben mich sofort fasziniert (ohnehin bin ich ein Zahlen-Daten-Fakten-Fan und habe nicht umsonst das Studium der VWL gewählt). Die Begeisterung war so groß, dass ich meinen alten Beruf an den Nagel hängte und Heilpraktikerin wurde. Meine Praxis führe ich seit 20 Jahren mit großer Begeisterung und bin – natürlich - auf Labordiagnostik spezialisiert und kann so oft vielen Symptomen auf den Grund gehen. In 2 Jahren hoffentlich dann auch als Ärztin.